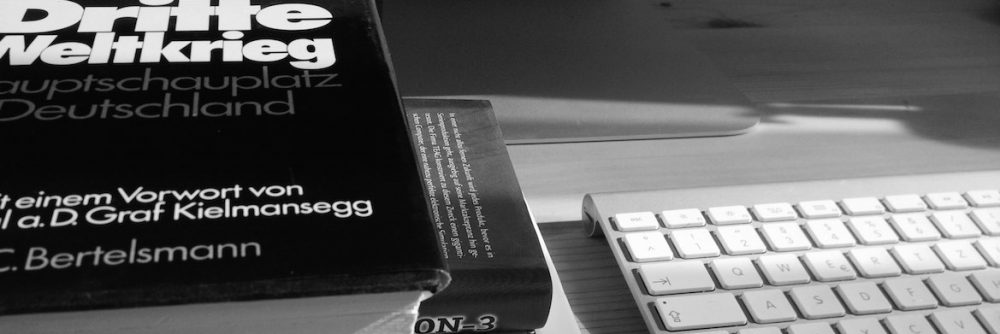Sakyo Komatsus Roman Der Tag der Auferstehung. Eine Buchbesprechung von Rob Randall
Zwei Buchreihen dominieren die Taschenbuchabteilung meines Bücherregals unübersehbar: Die erste ist die überwiegend in Regenbogenfarben fröhlich vor sich hinschillernde des Suhrkampverlages. Die andere: Ein monolithischer schwarzer Block von gut zwei Metern – und dabei besitze ich nur einen Bruchteil der mehrere tausend Titel umfassenden legendären Science Fiction & Fantasy Reihe aus dem Heyne Verlag. Ihr langjähriger Herausgeber Wolfgang Jeschke machte in den 70er und 80er Jahren durch diese nicht nur eine ganze Reihe junger deutscher SF-Autoren der breiten Öffentlichkeit bekannt, sondern auch erfolgreiche internationale SF dem Fan auf Deutsch zugänglich.
Zu letzteren Titeln gehört Sakyo Komatsus Katastrophenroman Der Tag der Auferstehung aus dem Jahre 1964, mit dem „Komatsu einer der Mitbegründer der modernen, eigenständigen und naturwissenschaftlich fundierten japanischen SF“ [1] wurde. Einigen dürfte Komatsu vielleicht durch die Romanvorlage zu dem Film „Der Untergang Japans“ bekannt sein.
Ein Rückblick auf die Katastrophe
Auch in Der Tag der Auferstehung geht Japan unter. Allerdings nicht alleine und nicht aufgrund von tektonischen Aktivitäten – obwohl auch diese zuletzt nicht weniger als einen Atomkrieg auslösen. Doch ruhig Blut: Da ist die Erde schon so gut wie menschenleer. Denn eine Seuche extraterrestrischen Ursprungs ist aus einem britischen Waffenlabor entkommen und hat die Erde – wenn man von den 10000 Menschen absieht, die in der Antarktis überlebt haben – innerhalb weniger Monate gänzlich entvölkert.
Komatsus Roman ist einer derjenigen, denen man nichts nimmt, wenn man ihr Ende verrät: Denn der Titel des Roman deutet es schon an: Die Menschheit überlebt beides, Pandemie und Atomschlag. Da ist es auch nur konsequent, wenn ein Rückblick auf den Weg in und durch die Katastrophe den überwiegenden Teil des Textes selbst ausmacht. Komatsu setzt deshalb vorwiegend auch nicht auf Spannung, obwohl die Helden zuletzt doch noch ein Rennen gegen die Zeit bestreiten müssen. Das Ende ist aber auch ganz bestimmt nicht der Grund, warum man diesen Roman lesen sollte.
Genau hingesehen
Die Stärke von Der Tag der Auferstehung ist vielmehr die detaillierte fiktionale Rekonstruktion von Geschehnissen, die zuletzt in einer Katastrophe für die Menschheit münden: Der Gefahren, die man eingegangen war, den Zufällen und verpassten Gelegenheiten, die sich ergaben. Die Warnung fällt dementsprechend sehr deutlich und – aus zeitgenössischer Sicht – hochaktuell aus: Waren doch erst 2 Jahre vor Erscheinen des Roman Watson, Crick und Wilkins „für ihre Entdeckungen über die Molekularstruktur der Nukleinsäuren und ihre Bedeutung für die Informationsübertragung in lebender Substanz“ mit dem Nobelpreis geehrt worden. Dieser wissenschaftliche Fortschritt potenzierte nur noch die Gefahren, die sich aus der seit dem Zweiten Weltkrieg betriebenen Biowaffenforschung der Großmächte im Kalten Krieg ergaben.
Komatsu erzählt mit deutlich spürbarem Vergnügen am Fabulieren und am technisch wissenschaftlichem Erklären. Manchmal schießt er dabei aber, wenn er über mehrere Seiten hinweg biochemische Vorgänge beschreibt, etwas über das Ziel hinaus. Wobei angemerkt sei: Fans der Hard Science Fiction dürften hier wohl noch nicht einmal zucken. Auf diesen Seiten kommt es auch zu jenen wenigen Momenten, in denen der Leser Längen verspürt.
Bedrückend
Schon zu Beginn des Romans lernt der Leser die eigentliche Hauptfigur des Romans kennen: Einen japanischen Wissenschaftler, aus dessen Perspektive der Leser zumindest weite Teile der Rahmenhandlung erlebt. Hier wie im Falle der tatsächlich recht zahlreichen anderen sympathischen Figuren ist es Komatsu gelungen, seinen literarischen Charakteren Glaubwürdigkeit und Tiefe zu verleihen – nur die Bösewichte sowie die bornierten bzw. ignoranten Militärs und Wissenschaftler kommen mal wieder etwas zu kurz. Was allerdings zu verschmerzen ist.
Bedrückende Stimmung kommt dabei schon gleich zum Beginn des Romans auf, wenn der Held mit einen Atom-Uboot vor seiner ausgestorbenen japanischen Heimatstadt vor Anker liegt. Gut möglich, dass Komatsu hier auf eine der eindringlichsten Szenen aus der Verfilmung von Das letzte Ufer zurückgreift. Aber er verstärkt die Wirkung dieses Bildes sogar noch, wenn er seine tauchende Hauptfigur sich wenige Zentimeter unter der Wasseroberfläche, die auf keinen Fall durchbrochen werden darf, trauern lässt. Da muss auch der Leser schlucken.
Fazit
Selbst derjenige, der wie ich ansonsten nicht gerade ein Fan japanischer Literatur ist, kann und sollte Der Tag der Auferstehung lesen. Denn Komatsu erzählt eindringlich und hoch realistisch – wenn man einmal vom wenig überzeugenden Ende absieht. Da fällt es schwer, den Roman aus der Hand zu legen, selbst wenn man mal die eine oder andere Seite wissenschaftlicher Darstellung überblättert.
[1] Michael Morgental, in: Sakyo Komatsu, Der Tag der Auferstehung, S. 333-335, S. 334.