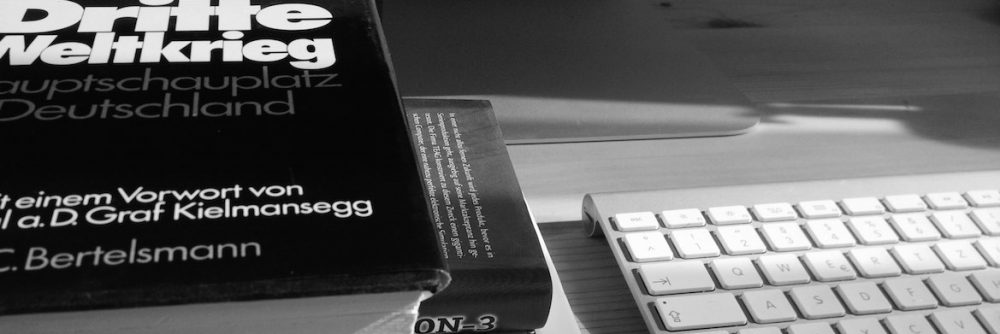Eine Rezension von Rob Randall
Bei Books on Demand hat der 51-jährige Controller Klaus Heimann im Jahr 2010 – passend zur Ruhr RUHR.2010 – einen dystopischen Roman veröffentlicht, in dessen Zentrum das lokale und globale Gefälle von Arm und Reich sowie die Frage nach dem Ursprung des Terrorismus stehen.
Heimann entwirft eine zukünftige Welt, in der sich die privilegierteren Bewohner dieses Planeten in Blessed Islands vor der am Rande des Existenzminimums dahin vegetierenden Menschheit – den Dirty People – nach den durch die Klimaveränderung hervorgerufenen katastrophalen Zuständen verschanzt haben. Ausgefeilte Sicherungsmaßnahmen einschließlich einer ideologischen Indoktrinierung der eigenen Bevölkerung ermöglichen es den Blessed People, ihren Wohlstand nach dem vor allem durch Wanderungsströme hervorgerufenen Zusammenbruch der uns bekannten Ordnung zu halten bzw. – im Vergleich zu heute – sogar zu vergrößern.
Zwei Welten
Im Zentrum des phantasievollen auktorial erzählten Science-Fiction Romans stehen der Leiter des Ideologiestabes des Blessed Island Rhein-Ruhr Karl und seine Frau Elisabeth. Der vom Konzept der Blessed Islands fest überzeugte Protagonist wird von seinem Vorgesetzten, dem Blessed Mayor zu einer wichtigen Konferenz der Oberhäupter der Wohlstandsinseln nach Canberra in Australien geschickt: Denn anscheinend ist es einer terroristischen Organisation aus dem Dirty Country des ehemaligen Deutschland gelungen, einen weitentwickelten und nur schwer unter Kontrolle zu bringenden Virus in das Computersystem der Blessed Islands einzuspeisen. Auf seinem Flug zur Konferenz wird Karl von einer zweiten Terrorzelle mit raffinierten Mitteln und unter abenteuerlichen Umständen entführt. Ziel des Anführers der über weitreichende technische Mittel verfügenden australischen Gruppe Dingo ist es, unter Erpressung Karls schleichende Veränderungen im Verhältnis von Blessed Islands und Dirty Country herbeizuführen, an deren Ende schließlich irgendwann die Aufhebung der Teilung der Welt stehen soll. Zusätzliche Spannung entwickelt die Handlung nicht nur durch das Einschleusen eines immer von der Entdeckung bedrohten “Spitzels” unter Karls Identität in die Konferenz der Blessed Mayors, sondern auch durch die Tatsache, dass Dingo in den teilweise recht aggressiv geführten Diskussionen mit Karl zunehmend die Kontrolle über sich verliert und das Leben des Protagonisten in größter Gefahr schwebt.
Die zuletzt genannte Unterhaltung stellt übrigens eine interessante Variation des im Genre der klassischen Dystopie so häufig anzutreffenden Motivs der die Hintergründe klärenden Diskussion zwischen dem sich gegen das System stellenden Protagonisten und dem dieses repräsentierenden Vertreters dar. Diese lässt sich sonst üblicherweise im letzten Drittel des Romans – und nicht in der Mitte – finden und geschieht normalerweise unter anderen Vorzeichen: Der Vertreter des Systems ist üblicherweise der die Regeln bestimmende Antagonist der Hauptfigur. Ein interessanter Versuch, der so aber insgesamt nicht ganz überzeugen kann:
Denn leider wirkt der insgesamt flüssig und angenehm zu lesende Roman nicht ganz so spannend, wie die oben referierte Handlung eigentlich erwarten lassen würde. Ursache hierfür sind die meiner Ansicht nach viel zu lang geratenen Abschnitte, in denen der Leser etwas über die historischen, politischen sowie philosophischen Hintergründe des Konzeptes der Blessed Islands erfährt bzw. die Stellen, an denen die Beteiligten die sich daraus ergebenden ethischen Fragen diskutieren. Dies betrifft zum einen die aus der Perspektive der Lehrerin Elisabeth erzählten Abschnitte, welche nichts zur eigentlichen Handlung beitragen, sondern dem Leser nur die zu den Blessed Islands führenden historischen Ereignisse darlegen. Zum anderen betrifft dieses auch die sich über zahlreiche Seiten ersteckenden Teile des Romans, in denen der Protagonist Karl und sein Gegenspieler Dingo über die Rechtfertigung der Spaltung der Welt in Arm und Reich streiten und die sich ganz am Ende des Romans anschließende Unterhaltung zwischen Elisabeth und dem Blessed Mayor der Blessed Island Rhein-Ruhr. Vor allem letzterer Abschnitt ist es auch, der den Eindruck, dass der Autor in der Konzeption seines Werkes der Versuchung erlegen ist, die literarische Grundlage den sich aus dem Thema ergebenden und nicht ganz unkomplizierten Fragen hintenanzustellen, abrundet. Es gibt allerdings – das muss man auch sagen – zeitgenössische Beispiele, in denen dieses in viel stärkerem Maße zu beobachten ist: z.B. Dirk C. Flecks Roman Das Tahiti-Projekt. So interessant und richtig die Beschäftigung mit Themen, die aller Voraussicht nach in Zukunft immer weiter an Bedeutung gewinnen werden, sein mag: Meine Erwartungen an gute Romane erfüllen solche Werke, in denen das Literarische nach und nach ins Hintertreffen gerät, nicht mehr. Dabei wirken jene Teile als Längen, welche die Funktion des oben genannten genretypischen Gespräches übernehmen, welches aufgrund der Anlage des Romans hier auf mehrere Abschnitte ‘aufgeteilt’ wird. Dadurch gelingt es zum einen natürlich dem Autor, genauer ins Detail zu gehen, andererseits lassen sich gewisse Redundanzen auch nicht vermeiden. Etwas weniger wäre meiner Ansicht nach hier mehr gewesen.
Zwei Romane
Wer schon einmal Jean-Christphe Rufins Roman Globalia aus dem Jahr 2004 gelesen hat, dem wird auffallen, dass die dort entworfene Welt der von Heimann in einer ganzen Reihe von Punkten ähnelt: In beiden Werken wird eine zweigeteilte Welt entworfen, die auf einer Ungleichheit basiert, die das heutige Wohlstandsgefälle spiegelt. Denn unverkennbar steht in beiden Romanen auch das Verhältnis von Industriestaaten und Dritter Welt im Zentrum der Betrachtung (So können sorgsam ausgewählte Dirty People bei Heimann durchaus Arbeit in der äußeren Zone der Blessed Islands finden – allerdings unter unwürdigen Arbeitsbedingungen) und die Frage nach dem Ursprung des aus den ärmeren Teilen der Welt hervorbrechenden Terrorismus. Sowohl in Rufins als auch in Heimanns Roman schottet sich der wohlhabendere Teil der Menschheit in kleinen Enklaven geradezu hermetisch vom Rest der Welt ab und überlässt diese ihrem Schicksal – wenn sie nicht gerade Gegenstand wie auch immer gearteter “imperialistischer” Bestrebungen ist. In beiden Fällen muss ein ans Totalitäre grenzendes System – das sich allerdings demokratisch gibt – errichtet werden, welches die auf Ungleichheit beruhende Ordnung gegen innere Feinde – die möglicherweise mit den besseren ethischen Argumenten ausgestattet sind – schützen muss, denn die eigenen ergeben sich vor allem aus praktischen Erwägungen. Dieses wird vor allem bei Heimann deutlich. Die in den Enklaven lebende Bevölkerung beginnt in beiden Romanen zudem eine Gesamtidentität jenseits der ursprünglich nationalen oder ethnischen auszubilden (wenngleich hier auch im Detail Unterschiede festzustellen sind).
In beiden Romanen führt also die Spiegelung der heutigen Teilung der Welt – in Rufins Werk etwas eher als in Heimanns – zu durchaus ähnlichen Ergebnissen in der verfremdenden Darstellung. So gelungen man die extrapolierenden Darstellungen der beiden Autoren auch bezeichnen muss, die von den Autoren erschaffenen Gesellschaften unterscheiden sich doch sehr deutlich in der analytischen Tiefe der Ausgestaltung: Während der von den verbotenen Zonen ausgehende Terror in Globalia sogar systemstabilisierend wirkt, bewirkt er in den Blessed Islands höchstens Racheaktionen. Zudem hat Rufin seine Welt weitaus detailreicher geschildert und z.B. die Dimensionen von ‘Unterhaltungsindustrie’ und ‘Demografischem Wandel’ ausgeleuchtet. Heimanns Roman konzentriert sich hingegen sehr stark auf einige wenige Aspekte, wodurch die fiktive Welt eindimensional wirkt.
Trotzdem: Der Roman behandelt tiefgehend ein aktuelles Thema und die Vorausschau von Heile Welt an Rhein und Ruhr wirkt nicht allzu weit hergeholt, wenn man sich einmal den die Grenze der U.S.A. nach Süden absichernden Grenzzaun oder die durch umfangreiche Überwachungsmaßnahmen geschützten Wohnsiedlungen für Wohlhabende in einigen südamerikanischen Staaten genauer betrachtet.
Fazit
Der gute Eindruck, den Klaus Heimanns eigentlich spannende Dystopie Heile Welt an Rhein und Ruhr macht, wird leider durch eine teilweise eindimensional wirkende Darstellung der fiktionalen Welt und einige Abschnitte mit deutlichen Längen getrübt, welche sich aus der vom Autoren angestrebten ‘aufklärerischen’ Wirkung ergeben. Ich persönlich finde das schade – Leser aber, die weniger das Literarische als das Thema selbst in den Vordergrund stellen, mögen dieses anders sehen.