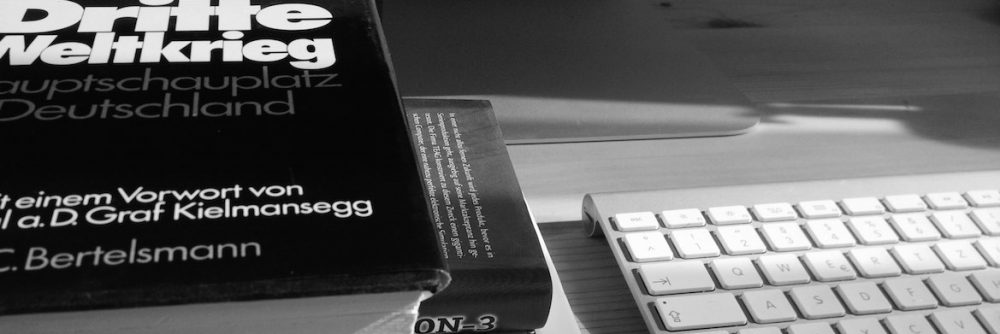Eine Rezension von Rob Randall
Postapokalyptische Romane, die in den U.S.A. spielen, gibt es wie Sand am Meer nach einer richtig fiesen Klimakatastrophe. Beispiele aus heimischen Landen hingegen – zumal solche, die nach dem Ende des Kalten Krieges und der Atomkriegsangst der 80er Jahre entstanden sind – finden sich hingegen viel seltener. Mit seiner diesjährigen Veröffentlichung Das Ende der Welt im Bloomsbury-Verlag hat der in Berlin lebende Autor Daniel Höra nun die Jugendbuchlandschaft hierzulande um einen wirklich düsteren Vertreter des Genres bereichert.
Das, was von diesem (unserem) Lande in Höras dystopischer Vision nach einer namenlosen Katastrophe übrig ist, verdient kaum noch die Bezeichnung “Staat”. In den verwanzten nund heruntergekommenen Großstädten verschanzen sich die Menschen gegen die Gesetzlosigkeit, die in den undurchdringlichen Wäldern und auf dem Lande herrscht. Rebellen und Terroristen treiben ihr Unwesen. In der Hauptstadt Berlin herrscht eine als dekadent apostrophierte Senatorenkaste (die ein wenig an die Senatorenschicht im kaiserlichen Rom erinnert), über die in Armut und Elend lebenden Zefs im ganzen Lande, gestützt auf eine Soldatenkaste, deren Angehörige schon in frühester Kindheit ausgewählt werden. Zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen herrschen Abscheu, Misstrauen und Hass.
Auch der 15-jährige Soldat Kjell hegt solche Vorbehalte gegenüber den Zefs und der politischen Elite des Landes. Als er mit seiner Einheit jedoch nach Berlin verlegt und in eine politische Intrige verwickelt wird, bei welcher es um nicht weniger geht als der Frage, welchen Weg Deutschland in Zukunft nehmen soll, sieht er sich nicht nur von allen seinen Freunden verraten, sondern gerät auch in große Gefahr. Gemeinsam mit Leela, der Tochter des abgesetzten Kanzlers Amandus begibt er sich auch eine abenteuerliche Flucht vor seinen ehemaligen Kameraden und Häschern des neuen Machthabers General Cato durch die norddeutschen Niederungen.
Düsteres Szenario
Schon zu Beginn trumpft Höras Postapokalypse mit den düstersten Beschreibungen auf, um dem Szenario eine insgesamt gelungene trostlose Grundstimmung zu verleihen: Auf dem Lande rückt unter einem giftig-gelben Himmel Kindersoldat Kjell mit seinen erwachsenen Kameraden in neblig sumpfigen Wäldern zu einer brutalen Strafaktion gegen die in Schuldknechtschaft dahinvegetierenden Zefs aus. In Berlin kaserniert bedrücken die trostlosen Zustände selbst den Protagonisten – obwohl er sich eines Kommentars enthält:
In den Straßen türmten sich die Müllhaufen. Ratten wuselten scharenweise darauf herum und verteidigten sie gegen hungrige Zefs. Manchmal war es umgekehrt. Verwesende Hundekadaver säumten die Ecken. Unter einer Plane ragten die Füße eines Toten hervor, der kurz zuvor von einer Pferdebahn zerquetscht worden war. Nicht weit von unserem Quartier entfernt stand ein alter Turm, der wie ein riesiger Schlagstock aussah.
Vergleicht man Höras Beschreibungen postapokalyptischer Landschaften und Städte mit denen anderer Jugendromane, so schneiden erstere sehr gut ab. Während in Pfeffers Die Verlorenen von New York dutzende Male die gleichen Bilder bemüht werden, wiederholen sich Szenerien bei Höra nicht. Ferner schießen die sprachlichen Bilder – wie im oben zitierten Beispiel – nie über das Ziel hinaus, sondern treffen den Kern. Auch wenn man der Umgebungsbeschreibung noch deutlich anmerkt, welche Wirkung bei der jungen Leserschaft letztendlich intendiert ist, trägt vor allem der neutral konstatierende Ton des Ich-Erzählers dazu bei, dass sich letzteres nicht unangenehm in den Vordergrund schiebt. Stilistisch kann man bei einem Jugendroman kaum mehr verlangen.
Spannende Mischung
Auch Höras Mischung aus spannender Verfolgungsjagd, politischer Intrige und verhaltenem amourösen Abenteuer kann überzeugen. Obwohl die Flucht vor den Schergen General Catos weite Teilen des Romans bestimmt, gerät die Handlung dennoch nicht flach – ein Problem, an dem die meisten Romane, welche auf dieses spannungsfördernde Moment setzen, leiden. Tiefe verleiht der Handlung dabei nicht nur das Rätselraten um die (möglicherweise) in die Intrige verwickelten Figuren, sondern ebenfalls die Folgen, die sich daraus für Kjells Persönlichkeitsentwicklung ergeben. Auch der Charakter seiner Begleiterin Leela fordert Kjell diverse Male dazu heraus, über seine Weltsicht zu nachzudenken – und diese zu revidieren. Damit entwickelt sich Kjell trotz aller Defizite vor allem im letzten Drittel zu einer Persönlichkeit, mit der sich der jugendliche Leser identifizieren kann – und Am Ende der Welt selbst letztendlich zu einem Entwicklungsroman.
Eine gelungene Hauptfigur
Zu Anfang dürfte dem Leser die Identifikation mit dem Ich-Erzähler allerdings kaum gelingen. Höra entwirft ihn – mit Blick auf dessen Lebensgeschichte höchst glaubwürdig – als in seinem Horizont doch stark beschränkten jungen Menschen – und das nicht ohne Humor. Trotz seiner kämpferischen Fähigkeiten droht der Protagonist damit an keiner Stelle zum Superhelden zu geraten. Als Kindersoldat sind Kjells Welterklärungen und Wertvorstellungen vielmehr stark durch die seit Jahren genossene spartanische Konditionierung geprägt. Damit dürfte er bei einigen der jungen Leser zu Beginn auf Ablehnung stoßen – diese aber auch dazu veranlassen, in Distanz zur Figur darüber nachzudenken, wie Kjell zu seinen Ansichten gekommen ist. Erst langsam, wenn in zunehmenden Maße Kjells Wertesystem ins Wanken kommt und dieser – teilweise vergeblich – gegen seine Prägung ankämpft, leidet und fiebert man mit ihm mit – und verzeiht ihm, dass er zuvor in überheblicher Weise beispielsweise Leelas Ausführungen über Fernsehgeräte abgelehnt und diese rätselhaften Geräte selbstsicher ins Reich der Mythen verwiesen hat. Höras Hauptfigur ist damit mit Sicherheit eines nicht: stereotyp.
Höras Ende der Welt: Zweimal kein Schluss
Verwundert blickt man aber als Leser am Schluss des Romanes zurück und fragt sich: “Wieso trägt der Roman einen solchen Titel?” Denn weniger als Das Ende der Welt selbst wird hier der Kampf um einen Neubeginn, persönlich wie gesellschaftlich, thematisiert. Vielleicht träfe Am Ende der Welt oder besser noch: Nach dem Ende den Inhalt genauer. Unter letzterem ist dieses Jahr aber schon ein Roman von Alden Bell erschienen, der eine ebensogute Mischung bietet – wenn auch nicht gerade für die jüngere Leserschaft.
Gestört hat mich persönlich auch, dass das Ende des Romanes keines ist, sondern dass überflüssigerweise auch noch eine kurze Herausgeberfiktion (Kjell, der 34.) einschließlich eines kleinen Wörterbuches angeschlossen wird. Auch wenn vor allem letzteres immer wieder schmunzeln lässt, erschließt sich mir seine Funktion als humoristisches Add-On für den Roman nicht.
Fazit
Ich kann Daniel Höras postapokalyptisches Jugendbuch Das Ende der Welt wirklich nur empfehlen: Neben düsteren Beschreibungen kommt das Buch mit einer so gar nicht stereotypen Hauptfigur daher, deren Charakterzüge den jugendlichen Leser durchaus ins Grübeln bringen dürften. Und vor allem: Spannend ist die Handlung von der ersten bis zu letzten Seite.