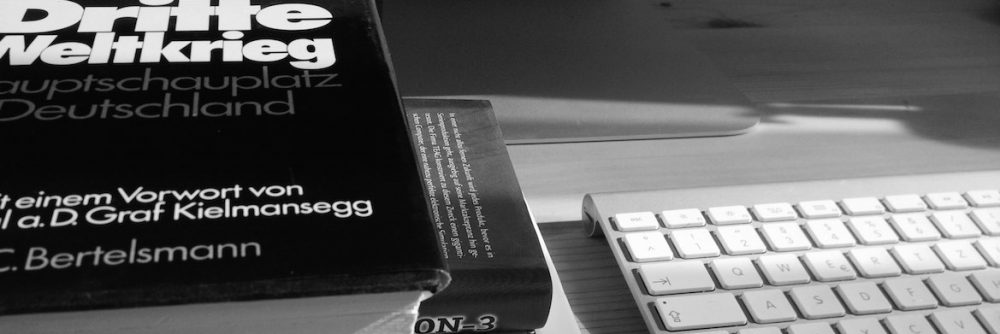Und wie würdet ihr handeln? P. D. James Dystopie „Im Land der leeren Häuser“. Eine Rezension von Rob Randall
Auf den Roman Im Land der leeren Häuser war ich wirklich gespannt – nicht weil ich die berühmte Krimiautorin P.D. James gekannt hätte (Schande über mein Haupt), sondern weil mir die Verfilmung Children of Men von Alfonso Cuarón so gefallen hatte.
Der 1992 erschienene und im Jahre 2021 spielende Roman besteht aus zwei Teilen: Omega und Alpha. Im ersten schildert der Ich-Erzähler Theodore Faron, seines Zeichens Geschichtsprofessor in Oxford, anhand von längeren Tagebucheinträgen die Situation in England, nachdem 1995 weltweit die letzten Kinder geboren worden sind, da alle Männer aus unerklärlichen Gründen unfruchtbar sind. Eine Vision, die angesichts des zunehmenden Bevölkerungsrückganges in den westlichen Industrienationen und den heute nachweisbar immer stärker auf die Fertilität einwirkenden Umweltgiften gar nicht so gewagt erscheint.
Das gesellschaftliche System, das James hier für das aussterbende England des beginnenden 21. Jahrhunderts entwirft, entspricht durchaus dem der klassischen Dystopie. Die Herrschaft ist an den Cousin des Ich-Erzählers, Xan Lyppiatt, gefallen , der als Warden of England mithilfe eines Rates in diktatorischer Form regiert. Eine mit Folter und Wahrheitsdrogen arbeitende Geheimpolizei (SSP) verfolgt die Gegner der sich gegen den Zusammenbruch des Landes stemmenden Despotie. Die in zweifelhaften Gerichtsverfahren abgeurteilten Kriminellen und Gegner werden auf die Isle of Man transportiert, um dort unter entsetzlichen Bedingungen weitgehend sich selbst überlassen zu werden. Die älteren Bürger werden nach feierlichen Zeremonien mehr oder minder freiwillig an abgelegenen Küstenorten auf dem offenen Meer ‘entsorgt’, was recht unauffällig geschehen kann, da angesichts des deutlich spürbaren Bevölkerungsrückganges die ländlichen Bereiche langsam aber sicher geräumt werden – denn nur in ausgewiesenen Ballungszentren wird die Versorgung der Einwohner in Zukunft noch sichergestellt werden können.
Es ist eine durchaus glaubhaft wirkende Apokalypse im Zeitraffer, die uns James hier vorführt. Sie verzichtet dabei weitgehend auf die dramatische Effekthascherei einer um sich schlagenden tyrannischen Exekutive – denn die absolute Herrschaft Xans wird angesichts der bedrohlichen Situation von der Bevölkerung wie auch vom vereinsamten Ich-Erzähler weitgehend akzeptiert, die Deportation der Kriminellen sogar befürwortet. Nur eine kleine Gruppe von Dissidenten hält die Zustände für untragbar und wendet sich deshalb an den Protagonisten, um über ihn Zugang zu Xan zu erhalten. Nachdem sein Versuch, den Warden of England davon zu überzeugen, dass die Missstände behoben werden müssen, scheitert, wird ihm zwar bewusst, dass einiges im Argen liegt, aber zu den gewaltsamen Aktionen der Gruppe kann er sich nicht durchringen. Der eher ruhige und immer noch an der Schuld für den Tod seiner jungen Tochter leidende Theodore hält Widerstand gegen das System für zwecklos. Nach einem warnenden Besuch der SSP in seinem wohligen Zuhause läuft er der doch irgendwie wahrgenommenen Verantwortung durch eine mehrmonatige Europareise davon.
Der Roman gewinnt vor allem stark durch Beschreibung der Vorkommnisse aus der nachvollziehbaren Perspektive Theodores – auch im weitgehend personal erzählten zweiten Teil. Seine inneren Konflikte, Gedanken und (fehlenden) Entscheidungen sind – auch wenn diese manchmal nur zwischen den von ihm verfassten Zeilen spürbar sind – durchweg gelungen und wirken glaubhaft. Zumal Theodore alles andere als eine aktive, geschweige denn heldenhafte Figur ist. Den ganzen Roman über scheint er durch die Ereignisse um ihn herum fremdgesteuert zu werden., sein Einsatz für die Ziele der Dissidentengruppe ist immer halbherzig, sein Leben grundsätzlich angepasst, seine Position stehts ein Kompromiss. Auch als im zweiten Teil des Romanes das Unglaubliche geschieht – ein weibliches Mitglied der ‘Rebellen’, das es dem rationalen Theodore besonders angetan hat, wird schwanger – versucht er einen Mittelweg zu finden: Einerseits sieht er sich aufgrund seiner Gefühle gezwungen, der Gruppe, die das Kind als Mittel zum Sturze der Regierung verwenden will, zu helfen, andererseits würde er lieber den Behörden das für die ganze Welt bedeutsame Ereignis melden und nicht in die Illegalität abtauchen. Erst die Flucht durch die weigehend verlassenen Landstriche Englands entwickelt sich zu seiner wirklichen quest, auf der er zum ersten Mal Verantwortung für andere zu übernehmen beginnt bzw. übernehmen muss.
Fazit
James ist es in diesem Roman gelungen, den inneren Konflikt zwischen gesellschaftlicher und menschlicher Verantwortung auf der einen Seite sowie anpassungsbereiter Rationalität und bürgerlichem Stillehalten auf der anderen in ihrer Hauptfigur glaubhaft zu gestalten. Dabei verzichtet sie insgesamt auf die deutlichen Überzeichnungen, die Samjatins Wir kennzeichnen, sowie auf die deutliche Präsentation von Herrschaft, wie sie für Orwells 1984 charakteristisch ist. Tatsächlich kann sich der Leser in der Hauptfigur, ihrem Wunsch nach Ruhe und bürgerlichem Dasein nicht nur wiederfinden, sondern er sieht sich mit dem durchaus sympathischen Helden zusammen im gar nicht so unrealistisch wirkenden Gedankenexperiment Im Land der stillen Häuser vor die Frage gestellt, ob er diese Existenz zugunsten der eigenen moralischen Überzeugung aufzugeben bereit wäre. Das ist eine große Leistung, die filmisch kaum umgesetzt werden kann. So verwundert es auch nicht, dass von der eigentlichen Handlung des Romanes, der Zeichnung der Figuren und dem geradezu ‘ruhigen’ Wesen der Diktatur Xans im Film Children of Men kaum etwas erhalten geblieben ist. Das braucht man hier aber keineswegs zu bedauern – denn beide sind auf ihre jeweils eigene Weise gelungen.